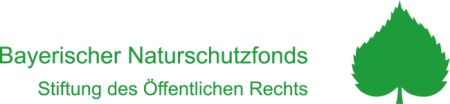Naturschutz in Schwaben
-

Die Abbildung zeigt
die Landkreise mit einer
Biodiversitätsberatung farblich grün
ausgefüllt (Donau-Ries, Dillingen
a.d. Donau, Günzburg,
Neu-Ulm,Unterallgäu,
Oberallgäu)Die Biodiversitätsberatung an den Unteren Naturschutzbehörden ist der lokale Ansprechpartner zur Förderung der Biodiversität im Regierungsbezirk Schwaben. Sie ist derzeit in sechs Landkreisen vertreten. In kooperativer Zusammenarbeit werden Flächeneigentümer und -eigentümerinnen, Landbewirtschaftende, Kommunen, Verbände und sonstige Akteure zum Abschluss von Förderprogrammen und bei der Beantragung von Maßnahmen, die dem Erhalt der Biodiversität dienen, beraten und unterstützt. Die Schwerpunkte der Tätigkeit liegen im Erhalt und der Optimierung der wertvollen Kernflächen des Naturschutzes (z.B. Flächen in Naturschutz- oder Natura 2000-Gebieten), der Förderung eines landesweiten Biotopverbundes und der Umsetzung von Artenhilfsmaßnahmen.
Die Regierung von Schwaben, als Höhere Naturschutzbehörde, koordiniert und unterstützt die Arbeit der Biodiversitätsberatung in Schwaben.Ansprechpartner
Koordination der Biodiversitätsberatung
Wieland Feuerabendt
Telefon +49 (0)821 327-2297
wieland.feuerabendt@reg-schw.bayern.de
Kontakte in den Landkreisen
Landkreis Name E-Mail/Telefon Donau-Ries Andrea Wadenstorfer andrea.wadenstorfer@lra-donau-ries.de
0906 - 74 288Dillingen a. d. Donau Isabella Schalk isabella.schalk@landratsamt.dillingen.de
09071 - 51 380Günzburg Judith Kronberg j.kronberg@landkreis-guenzburg.de
08221 - 95 384Neu-Ulm Jonas Benner jonas.benner@lra.neu-ulm.de
0731 - 7040 33111Unterallgäu Fabienne Finkenzeller fabienne.finkenzeller@lra.unterallgaeu.de
08261 - 995 671Oberallgäu Birgit Marzinzig birgit.marzinzig@lra-oa.bayern.de
08321 - 612 250
-

Idas-Bläuling (Plebejus idas); Foto: Wieland FeuerabendtDie Regierung von Schwaben fördert den Erhalt der Arten und Lebensräume über die Durchführung verschiedener Biodiversitätsprojekte. Das übergeordnete Ziel ist es, die heimische Artenvielfalt von über 14.000 nachgewiesenen Arten und 50 unterschiedlichen Lebensräumen (wie z.B. Mähwiesen, Hochmoore und Orchideen-Buchenwälder) auch für künftige Generationen in Schwaben zu bewahren. Dies sichert langfristig auch essenzielle Ökosystemdienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger Schwabens.
Die Ökosystemdienstleistungen sind eng mit der Arten- und Lebensraumvielfalt verbunden; sie sind essenziell für unsere Existenz. Wälder fungieren beispielsweise als natürliche Luft- und Wasserfilter, Moore können große Mengen Wasser und Kohlendioxid speichern, sie mildern so Hochwasserereignisse und tragen wesentlich zum Klimaschutz bei.
Insekten sind Bestäuber für zahlreiche Nutzpflanzen wie Äpfel, Raps und Kirschen und damit für unsere Nahrungsmittelversorgung unverzichtbar. Pflanzliche Rohstoffe sind auch für die Industrie und Medizin von großer Bedeutung. Viele Wirkstoffe und Wirkmechanismen sind dabei noch nicht bekannt und drohen durch das fortschreitende, rapide Artensterben für immer verloren zu gehen.
Auch die Bodenbildung baut fundamental auf der Artenvielfalt auf. Nur vitale, funktionierende Ökosysteme können leistungsfähige Böden bilden. Die dort zahlreichen Pilze und Mikroorganismen erhöhen durch ihre Arbeit im Boden die Fruchtbarkeit von Äckern und Wiesen und fördern so wiederum die Produktivität und Anpassungsfähigkeit der Landwirtschaft in Zeiten des Klimawandels.
Die Schönheit einer Landschaft, aber auch scheinbar selbstverständliche Dinge wie das morgendliche Vogelkonzert sind ebenfalls als wichtige Ökosystemdienstleistungen hervorzuheben. Diese vermitteln uns ein Heimatgefühl und sind gleichzeitig eine wesentliche Grundlage für die Erholung und den lokalen Tourismus, wie beispielsweise im Allgäu, in den Lechauen oder in der Rieslandschaft im Norden von Schwaben. Um die Ökosystemleistungen zu bewahren, muss die Biodiversität (Arten- und Lebensraumvielfalt) erhalten werden. Diese Zielsetzung wird durch die Regierung von Schwaben mithilfe von Projekten gefördert. Im Fokus dieser Biodiversitätsprojekte stehen meist eine oder mehrere Zielarten oder Lebensräume, die in Schwaben selten geworden sind. Für die Umsetzung dieser Ziele ist die Zusammenarbeit mit den Kommunen und lokalen Verbänden, mit der Landwirtschaft und anderen privaten und öffentlichen Akteuren unabdingbar.
Ausgewählte Biodiversitätsprojekte in Schwaben
-

Eine Wechselkröte (Bufo viridis) sitzt auf steinigem Untergrund; Foto: Felix Vogt-Pokrant.Projektzeitraum: 2020-2021
Zielsetzung/Beschreibung:
Die ehemalige Tongrube Glon im Landkreis Aichach-Friedberg ist Lebensraum der letzten bekannten Population der Wechselkröte (Bufo viridis) im Regierungsbezirk Schwaben und beherbergt außerdem eine überregional bedeutsame Population des Laubfroschs (Hyla arborea).
Die Wechselkröte ist eine Charakterart sonniger, offener und warmer Pionierstandorte. Ihre ursprüngliche Heimat waren weiträumige natürliche Flussniederungen mit hoher Dynamik des Entstehens und Vergehens von temporären, vegetationsfreien Kleingewässern und Feuchthabitaten im Umland. Als Landlebensräume besiedelt die Art trockene und warme Ruderalstandorte, Brachen und Wälder, die oft weitab der Laichgewässer liegen und lockere, sandige Böden aufweisen müssen, in die sich die Tiere eingraben können.
Diese ungestörten Landschaftsräume sind heute selten geworden und die Art ist daher stark auf Ersatzbiotope wie etwa Kies- und Tongruben mit temporären kleinen und flachen Gewässern angewiesen. In Bayern ist die Art vom Aussterben bedroht, in Deutschland ist sie stark gefährdet (Rote Liste Deutschland: Kategorie 2; Rote Liste Bayern: Kategorie 1).
Der Laubfrosch benötigt hingegen permanent wasserführende, sonnige Laichgewässer mit Flachwasserbereichen und angrenzenden, reich strukturierten Landlebensräumen wie Sümpfen, Gebüschen und Hochstaudenfluren. Die Gewässer müssen zudem fischfrei sein, da die Fische den Laich des Laubfroschs fressen. Auch der Laubfrosch ist in Bayern und Deutschland stark gefährdet (Rote Liste Bayern und Deutschland: jeweils Kategorie 2).
Aufgrund ihres starken Rückgangs sind sowohl der Laubfrosch als auch die Wechselkröte nach Bundesnaturschutzgesetz und Europäischem Recht streng geschützt.
Die etwa 13 Hektar große Tongrube Glon befindet sich im Eigentum der Kreisgruppe Augsburg des Landesbund für Vogelschutz (LBV). Für die Tongrube liegt ein inzwischen veraltetes Entwicklungs- und Pflegekonzept von 2002 vor, das in diesem Projekt aktualisiert wird. In den Jahren 2012 - 2013 wurde, im Rahmen des Artenhilfsprogramms „Artenhilfsmaßnahmen bedrohter Amphibienarten“, eine Erfassung der Vorkommen der Wechselkröte durchgeführt, ein Maßnahmenkonzept ausgearbeitet und anschließend zunächst in Teilen umgesetzt. Im Fokus standen die Anlage von zahlreichen Tagesverstecken (u.a. Totholz- und Sandhaufen sowie Nagelfluhfelsen), die Anlage von Überwinterungsquartieren (u.a. Stein- und Asthaufen sowie Sandaufschüttungen) und die Neuanlage von Laichgewässern.
Die vorhandenen kleinen Gewässer drohen jedoch auszutrocknen oder zuzuwachsen. Auch das Zuwachsen der offenen Pionierstandorte und Tagesverstecke im Umfeld stellt ein Problem dar. Daher werden regelmäßig weitere unterschiedliche Biotoppflegemaßnahmen für die Wechselkröte durchgeführt. Um den bestehenden Bestand der Wechselkröte zu stützen, wurden u.a. bereits Teiche ausgeräumt, Flachteiche abgeschoben und mit Teichfolien ausgelegt, um das vollständige Austrocknen während Trockenphasen zu vermeiden, sowie Kaulquappen umgesiedelt. Seit 2021 werden jährlich solche Maßnahmen zum Erhalt der Lebensräume für die Wechselkröte und andere Amphibien durch die Kreisgruppe Augsburg durchgeführt, die mit der Regierung von Schwaben und weiteren Artexperten abgestimmt werden.
Förderung: Das Projekt wurde durch das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz über die Regierung von Schwaben gefördert.
Kooperationspartner: LBV Kreisgruppe Augsburg
Landkreis: Aichach-Friedberg

Ein trockengefallenes Kleingewässer in dem ehemaligen Abbaugebiet; Foto: Felix Vogt-Pokrant.
Abgeschobene Flachwasserbereiche als Laichhabitat für viele Amphibienarten; Foto: Felix Vogt-Pokrant.
-
Projektzeitraum: 2021-2023
Zielsetzung/ Beschreibung:
Das Haselbachtal ist eine wichtige landkreisübergreifende Feuchtlebensraum-Achse, die die Landkreise Unterallgäu und Günzburg verbindet. Das schmale Tal ist neben zunehmender Nutzungsintensivierung wiederum abschnittsweise auch von Nutzungswechseln und -aufgaben und damit Brachen geprägt.
Das vorliegende Biotopvernetzungskonzept strebt an, diese wertvolle Verbundachse zu sichern und weiterzuentwickeln. Dabei stehen die Erhaltung und Entwicklung von Offenland mit Streuwiesen, artenreichen Feuchtwiesen und dem naturnahen Bachverlauf im Mittelpunkt, da viele bedrohte Arten auf diese extensiven, offenen Lebensräume angewiesen sind. So konnten innerhalb der Projektkulisse mit einer Fläche von 180 ha 40 Brutvogel-, 6 Amphibien- und 2 Reptilien-, 28 Tagfalter, 32 Libellen- und 14 Heuschreckenarten nachgewiesen werden. Diese Vielfalt gilt es weiterhin gemeinsam mit den Menschen vor Ort zu erhalten und so die vielfältigen Ökosystemdienstleistungen langfristig zu sichern.
Förderung: Das Projekt wurde durch das Bayerische Staatsministerium für Umwelt gefördert. Die Mittelbetreuung liegt bei der Regierung von Schwaben.
Träger/ Ansprechpersonen: Regierung von Schwaben, Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt Unterallgäu, Landschaftspflegeverband Unterallgäu

Artenreiche Mähwiese mit vielen blühenden Kräutern; Foto: Regierung von Schwaben, Ricarda Rettinger.
Der mäandrierende Haselbach fördert durch die ihm eigene Dynamik das Entstehen und Fortbestehen vieler Lebensräume, die für spezialisierte Arten notwendig sind. So benötigen beispielsweise die heimischen Röhrichtbrüter wie Teichrohr- und Drosselrohrsänger Schilfgebiete, um ihre Nester zu bauen; Foto: Regierung von Schwaben, Ricarda Rettinger.
Die kolbenförmigen rosa Blüten des Schlangen-Knöterich (Bistorta officinalis) sind nicht nur schön, sondern dienen auch den Raupen des Blauschillernden Feuerfalters (Lycaena helle) und des Randring-Perlmutterfalters (Boloria eunomia) als Nahrungsquelle; Foto: Regierung von Schwaben, Ricarda Rettinger.
-

Artenreiche Wiesen sind besonders gut an den verschiedenen Blütenfarben und -formen zu erkennen; Foto: Claudia Gruber.
Maßnahmen zur Anreicherung von Pflanzenarten mit dem Ziel, eine artenreiche Blühwiese zu schaffen. In diesem Arbeitsgang wird der Boden gefräst und bietet so anschließend bessere Bedingungen für das Keimen von Samen; Foto: Claudia Gruber.Projektzeitraum: 2019-2024
Zielsetzung/ Beschreibung:
Blütenreiche und auffällig bunte Wiesen waren bis vor wenigen Jahrzehnten ein prägender Bestandteil der bayerischen Kulturlandschaft. Heute dagegen sind sie nicht nur in Bayern sehr selten geworden und stehen deshalb europaweit unter Schutz.
Bei den Mähwiesen handelt es sich, wie der Name schon sagt, um einen Lebensraum, der durch Mahd – also durch landwirtschaftliche Nutzung – entstanden ist. Traditionell werden diese Wiesen ein- bis maximal dreimal pro Jahr gemäht. Das Mahdgut wird meist getrocknet und als Heu genutzt. Da Düngemittel früher knapp waren, wurden die Wiesen nicht oder nur mit Festmist gedüngt. Diese extensive Nutzung führte dazu, dass viele Kräuter wie Wiesen-Salbei, Wiesen-Witwenblume, Wiesen-Bocksbart, Wiesen-Platterbse und Wiesen-Margerite das Erscheinungsbild der nährstoffarmen Mähwiesen prägten. Die artenreichen, bunten Wiesen stellen zudem einen wertvollen Lebensraum für Insekten wie etwa den hoch spezialisierten Wiesenknopf-Ameisenbläuling dar.
Schon die Historie von Mähwiesen verweist auf den wichtigsten Partner in diesem Projekt: die Landwirtschaft. Landwirtinnen und Landwirte sind deshalb herzlich dazu eingeladen, mitzuwirken und einen nachhaltigen Beitrag für kommende Generationen zu leisten. Durch verschiedene Förderprogramme werden sie bei der extensiven Bewirtschaftung und Wiederherstellung ihrer artenreichen Wiesen finanziell unterstützt und diesbezüglich beraten. Die Kosten für die Artanreicherung auf verarmten Extensivwiesen werden durch das Projekt getragen. Das Projektgebiet umfasst weite Teile des Ostallgäus und konzentriert sich dabei auf FFH-Gebiete und Biotopverbundachsen. Letztere sollen die Vernetzung der einzelnen FFH-Gebiete begünstigen.
Ein wichtiger Eckpfeiler des Projekts ist die Erfassung der noch bestehenden artenreichen Wiesen, da die Verbreitung im Landkreis weitgehend unbekannt ist. Hierzu werden im Projektgebiet potenzielle Flachland- und Bergmähwiesen erfasst und hinsichtlich ihrer Artenausstattung bewertet.
Neben der Sicherung von noch vorhandenen Mähwiesen durch die Fortführung einer extensiven und nachhaltigen Nutzung steht die Wiederherstellung und lokal auch die Neuschaffung von artenreichen Wiesen im Vordergrund. Dies soll durch Mahd- bzw. Saatgut-Übertragsverfahren mit selbst gewonnenem, autochthonem Pflanzenmaterial erfolgen (das ist Saatgut, das aus demselben sogenannten „Herkunftsgebiet“ stammt, im Idealfall lokal von nahe benachbarten Wiesen im Umfeld der neu zu entwickelnden Wiese gewonnen wird) – um so die lokale genetische Vielfalt der Flora zu erhalten und zu stärken.
Förderung: Das Projekt wird durch das Bayerische Staatsministerium für Umwelt gefördert. Die Mittelbetreuung liegt bei der Regierung von Schwaben.
Träger/ Ansprechpersonen: Regierung von Schwaben, Landschaftspflegeverband Ostallgäu

Blütenreiche, magere Flachlandmähwiese an einem nach Süden exponierten Hang. Margerite, Wiesenbocksbart, Witwenblume, Zittergras, Kammgras und Rot-Schwingel sind auf dem Bild erkennbar. Im Hintergrund blickt man auf die Ostallgäuer Alpen; Foto: Claudia Gruber.
Förderprogramme und Ansprechpartner
-
Das bayerische Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) hat seit 1982 zum Ziel, Landwirte für die naturverträgliche Pflege und Bewirtschaftung ihrer Flächen zu honorieren. Das VNP verfolgt einen kooperativen Ansatz, es beruht also auf Freiwilligkeit. Landwirte, die naturschutzfachlich abgestimmt Flächen bewirtschaften, können über das Programm ein Entgelt für den höheren Aufwand bzw. den entgangenen Ertrag erhalten. Das VNP ist ein Instrument, mit dem Naturschutz und Landwirtschaft Hand in Hand auf eine Steigerung der Artenvielfalt hinwirken können. Aktuell beteiligen sich ca. 4.000 landwirtschaftliche Betriebe an einer naturnahen und extensiven Bewirtschaftung ihrer Flächen, die zusammen über 25.000 ha umfassen. Interessenten wenden sich bitte an die Untere Naturschutzbehörde ihres Landkreises oder ihrer kreisfreien Stadt.

Artenreiche Flachlandmähwiese mit Wiesenknopf, der Futterpflanze für die Raupen des Wiesenknopf-Ameisenbläulings; Foto: Regierung von Schwaben, Susanne Kuffer.
-
Das Bayerische Vertragsnaturschutzprogramm Wald (VNP Wald) honoriert mit Zuwendungen freiwillige Leistungen, welche private oder körperschaftliche Waldbesitzer (inkl. Waldrechtler) sowie Träger überbetrieblich durchgeführter Maßnahmen für den Natur- und Artenschutz in ihren Wäldern erbringen. Das VNP Wald ist im Privatwald und im Körperschaftswald ein wichtiger Baustein für die Umsetzung naturschutzfachlicher Ziele des Europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 sowie der Bayerischen Biodiversitätsstrategie. Eine Antragstellung ist innerhalb des jährlich festgelegten Antragszeitraums bei dem für den Betrieb zuständigen Revierförster am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten möglich. Die Untere Naturschutzbehörde beim jeweiligen Landratsamt oder der kreisfreien Stadt prüft, ob eine Maßnahme die Voraussetzungen für die Teilnahme am VNP Wald erfüllt.

Ein naturnaher Wald mit liegendem Totholz (Foto aus dem Bayrischen Wald). Etwa 50 % aller Arten im Wald sind direkt oder indirekt auf liegendes oder stehendes Totholz angewiesen; Foto: Klaus Möller.
-
Im Rahmen der Landschaftspflege- und Naturparkrichtlinien (LNPR) werden Maßnahmen zur Pflege, Wiederherstellung und Neuschaffung ökologisch wertvoller Lebensräume gefördert. Antragsberechtigt sind Verbände, Kommunen und Eigentümer oder Besitzer von Grundstücken, auf denen Pflegemaßnahmen stattfinden sollen. Die Maßnahmen dienen insbesondere dem Aufbau des europäischen Schutzsystems Natura 2000, der Umsetzung des bayerischen Streuobstpaktes und des bayerischen Biotopverbunds sowie der Umsetzung der Strategie zur Erhaltung der Biologischen Vielfalt in Bayern (Bayerische Biodiversitätsstrategie).
Interessierte können sich an die zuständige Untere Naturschutzbehörde ihres jeweiligen Landkreises wenden.
-
Zur Umsetzung der Strategie zum Erhalt der biologischen Vielfalt in Bayern stellt das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz eigenständige Haushaltsmittel zur Verfügung. Diese werden in Form der Biodiversitätsprojekte eingesetzt (siehe oben).
Ansprechpartner für die Biodiversitätsprojekte ist die Regierung von Schwaben
-
Der Bayerische Naturschutzfonds ist eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in München. In vielen Projekten unterstützt die Stiftung die Umsetzung der wichtigsten Naturschutzkonzepte im Freistaat – unter anderem die Bayerische Biodiversitätsstrategie, das Arten- und Biotopschutzprogramm, Artenhilfsprogramme und den Biotopverbund in Natura 2000 sowie das BayernNetzNatur. In Rücksprache mit den Unteren und der Höheren Naturschutzbehörde sowie dem Naturschutzfonds können Projekte beantragt werden. Darüber hinaus ist in bestimmten Fällen eine Kofinanzierung des Bezirkes Schwaben möglich.
Weiterhin ermöglicht der Naturschutzfonds dem Bund Naturschutz Bayern e.V., dem Landesbund für Vogelschutz e.V. und dem Deutschen Verband für Landschaftspflege e.V. als Trägern die Durchführung von "Kleinmaßnahmen aus Zweckerträgen der GlücksSpirale". Kennzeichen der Projekte sind der unmittelbare Praxisbezug, eine enge Abstimmung mit den Akteuren vor Ort und eine effektive, unbürokratische Abwicklung sowie eine vorbildliche Kooperation von Verbänden und Naturschutzverwaltung.
Interessenten wenden sich bitte an den Bayerischen Naturschutzfond